
Open Source und digitale Souveränität
Transparenz, Gemeinschaft und Zusammenarbeit stärken die Autonomie.
Im Namen von Geschwindigkeit und Komfort verstricken sich viele Organisationen zunehmend in ein komplexes Netz von Abhängigkeiten gegenüber Drittanbieterlösungen außerhalb ihres direkten Einflussbereichs – häufig handelt es sich dabei um proprietäre Software oder cloudbasierte Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformen. Der Preis für diesen Komfort ist der schleichende Verlust der Kontrolle über geschäftskritische Daten und Abläufe. Das wachsende Bewusstsein für dieses Risiko rückt das Thema digitale Souveränität in den Fokus – ein Konzept, das wir in diesem Artikel gemeinsam mit der Rolle von Open-Source-Software bei ihrer Sicherung näher beleuchten.
Digitale Souveränität bezeichnet die Fähigkeit von Regierungen, Organisationen, Unternehmen oder Einzelpersonen, die unabhängige Kontrolle über ihre digitalen Ressourcen, Daten und Prozesse zu bewahren
"Digitale Souveränität bedeutet, dass man in allen digitalen Belangen unabhängig agieren kann – ohne ungebührlichen Einfluss durch externe Akteure oder fremde Mächte. Sie sichert die Autonomie über Daten, Ressourcen und die Sicherheit der eigenen IT-Systeme."
- Daniel Fau, CEO der TYPO3 GmbH
Ein Hinweis zur Terminologie: Digitale Souveränität, manchmal auch als digitale Autonomie bezeichnet, umfasst digitale Governance (Regulierung und Kontrolle von Abläufen, Richtlinien und Infrastruktur) und Datensouveränität (Kontrolle von Daten und digitalen Assets, deren Speicherung und Nutzung). Weitere Informationen finden Sie unter Digitale Souveränität und Datensouveränität: die Unterschiede verstehen.
Auf dem Weg zur digitalen Autonomie: Standort + Open Source
Wer seinen Technologie-Stack externen Anbietern anvertraut, überlässt ihnen zwangsläufig Verfügbarkeit, Sicherheit und Vertraulichkeit der eigenen digitalen Ressourcen, Daten und Anwendungen. Einige dieser Anbieter befinden sich in Ländern, in denen sensible Daten durch staatliche Überwachung oder gesetzlich erzwungene Offenlegung gefährdet sind. Geschäftskritische Software, die außerhalb des eigenen Einflussbereichs betrieben wird – etwa auf SaaS- oder Hosting-Plattformen von Drittanbietern – kann dadurch zweckentfremdet oder dauerhaft unzugänglich werden.
Um digitale Selbstbestimmung tatsächlich auszuüben, ist zudem uneingeschränkter Zugang zu und Kontrolle über die eingesetzte Software erforderlich. Proprietäre Technologien sind häufig mit Nutzungseinschränkungen – etwa nutzerbezogenen Lizenzen – und einer Herstellerabhängigkeit verbunden. Freie und Open-Source-Software (FOSS) hingegen darf per Definition frei genutzt, untersucht, verändert und weitergegeben werden.
Digitale Autonomie ist nur erreichbar, wenn FOSS-Anwendungen betrieben und Daten sowie digitale Ressourcen auf eigener Infrastruktur gespeichert werden – oder zumindest innerhalb von Rechtsräumen wie der Europäischen Union (EU), die über starke Datenschutz- und Privatsphäregesetze verfügen.
Dieser Artikel befasst sich mit digitaler Souveränität und damit, wie Open-Source-Technologien sie für uns als Einzelpersonen, Organisationen und Institutionen erreichbar machen:
- Einleitung: Open Source und digitale Souveränität
- Historischer Kontext und Entwicklung der digitalen Souveränität
- Digitale Souveränität im europäischen Kontext
- Open-Source-Software: Katalysator für Unabhängigkeit
- Digitale Souveränität vs. Datensouveränität: die Unterschiede verstehen
- Praktische Auswirkungen der digitalen Souveränität
- Herausforderungen und Lösungen bei der Verwirklichung digitaler Souveränität
- Praktische Anwendungen und Fallstudien zur digitalen Souveränität
- Zukünftige Trends und Vorhersagen
- Der weitere Weg zu digitaler Souveränität und Open Source
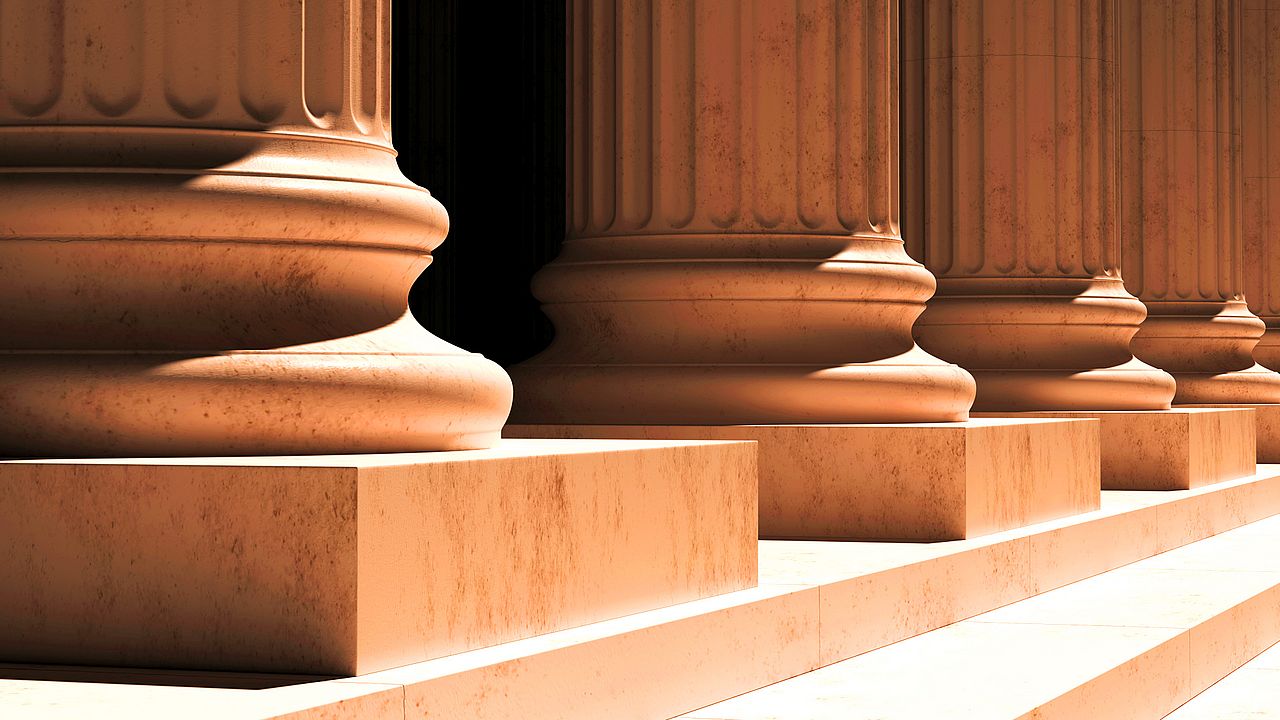
Historischer Kontext und Entwicklung der digitalen Souveränität
In den Anfangstagen war die digitale Landschaft von großen Konzernen mit proprietären Systemen geprägt, die sowohl den Hardware- als auch den Softwarebereich dominierten – man denke an IBM und andere. Es kam zu Interessenkonflikten zwischen Unternehmen und Regierungen, die versuchten, die Nutzung und den Schutz nationaler Daten zu regulieren oder zu sichern, doch der breiten Öffentlichkeit blieben diese Auseinandersetzungen auf hoher Ebene meist verborgen.
Ein allgemeines Bewusstsein für digitale Souveränität auf individueller Ebene existiert in der Gesellschaft seit dem Aufkommen praktikabler Personal Computer in den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren. Der Blick auf die parallele Entwicklung von Informationstechnologie und Souveränitätsverständnis hilft, heutige Perspektiven und Rahmenbedingungen besser zu verstehen.
Die ersten Vertreter freier Software, wie Richard Stallman, haben frühzeitig darauf hingewiesen, dass wir digitale Freiheit und Autonomie gegenüber externer Kontrolle über unsere Geräte und Aktivitäten benötigen. Wir ignorierten diese Warnung auf eigene Gefahr. Die Verbreitung und spätere Allgegenwart des Internets in nahezu allen Lebensbereichen vieler Weltregionen ging einher mit den datenzentrierten und die Privatsphäre untergrabenden Geschäftsmodellen der Tech-Giganten des 21. Jahrhunderts. Dadurch wurden Debatten und Konflikte um Dateneigentum, rechtliche Zugriffsmöglichkeiten und grenzüberschreitenden Informationsfluss massiv beschleunigt.
Regierungen sahen sich zunehmend veranlasst, Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur und die Daten ihrer Bürger zu behalten – auch weil Konzerne zunehmend in Frage stellten, ob der Begriff des Nationalstaats im digitalen Raum überhaupt noch relevant sei. Regulatorische Maßnahmen wurden ergriffen, um sich gegen äußere Einflussnahme, Cyber-Spionage und die monopolistischen Tendenzen großer Tech-Unternehmen zu schützen. Organisationen, Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen standen vor ähnlichen Herausforderungen und hegten ähnliche Bedürfnisse.
Wie lässt sich die Kontrolle zurückgewinnen? Natürlich mit freier und Open-Source-Software!
Meilensteine der Open-Source-Entwicklung
Open-Source-Software, die auf Transparenz und kollektiver Beteiligung beruht, spielt eine zentrale Rolle bei der Verwirklichung digitaler Souveränität. Die folgenden Meilensteine trugen wesentlich zur Demokratisierung der Softwareentwicklung bei. Sie haben die Bedeutung offener Systeme und der Autonomie im digitalen Bereich bekräftigt:
- Die Gründung des GNU-Projekts (1983): Dieses von Richard Stallman initiierte Projekt zielte darauf ab, ein völlig freies und offenes Unix-ähnliches Betriebssystem zu schaffen. Es legte die Grundprinzipien von Open Source und öffentlicher Zusammenarbeit fest.
- Die Veröffentlichung des Linux-Kernels (1991): Linus Torvalds veröffentlichte den Linux-Kernel, der eine entscheidende Komponente für das im Entstehen begriffene GNU-System darstellte und ein vollständig quelloffenes Betriebssystem schuf, das von den Beiträgen der Gemeinschaft lebte.
- Das Apache HTTP Server Projekt (1995): Nach der Veröffentlichung des quelloffenen HTTP-Servers, der später einen großen Teil des World Wide Web antreiben sollte, wurde die Apache Software Foundation zu einem Eckpfeiler des Open-Source-Ökosystems.
- Die Open Source Initiative (OSI) (1998): Die OSI hat die Definition von Open Source formalisiert und den rechtlichen Rahmen für Open Source Software gestärkt. (Die TYPO3 Association ist Mitglied der OSI und Unterzeichner der Open Source Definition).
- Der Aufstieg von Open Source in Unternehmen (ab den 2000er Jahren): Nachdem Unternehmen wie Red Hat die Tragfähigkeit von Open-Source-basierten Geschäftsmodellen bewiesen hatten, erkannten viele andere Unternehmen den strategischen Wert der Unterstützung digitaler Souveränität und begannen, Open-Source-Projekte zu übernehmen und zu unterstützen.

Digitale Souveränität im europäischen Kontext
Die digitale Souveränität ist in der Europäischen Union zu einem immer wichtigeren Ziel und Anlass zur Sorge geworden. Unternehmen und Institutionen des Kontinents haben erkannt, dass die digitale Wirtschaft zunehmend von nicht-europäischen Akteuren abhängig ist. Datenschutz, Datensicherheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit sind unsicher, wenn digitale Infrastrukturen – wie Cloud-Dienste, Telekommunikation und Rechenzentren – von globalen Technologiekonzernen oder anderen Akteuren außerhalb Europas kontrolliert werden.
Neben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die den digitalen Schutz in Bezug auf Privatsphäre, Datenspeicherung und Datenverarbeitung stärkt, arbeitet die Europäische Union an neuen Regelungen für ein digital orientiertes Wirtschaftswachstum innerhalb ihrer Grenzen.
Fallstudien: Die digitalen Strategien der Europäischen Union
Die Europäische Union hat gezielte Anstrengungen unternommen, um Rahmenwerke und Richtlinien zu schaffen, die digitale Souveränität ermöglichen und fördern. Die EU ist bereits ein bedeutender Nutzer und Beitragsleister im Bereich der Open-Source-Software. Die neuen Rahmenwerke und politischen Maßnahmen bieten rechtliche und wirtschaftliche Vorteile für Open-Source-Projekte. Sie werden die gegenseitig vorteilhafte, symbiotische Beziehung weiter stärken, da immer mehr europäische Regierungen die Vorteile der Nutzung von Open-Source-Produkten erkennen.
Die folgenden Initiativen zeigen, wie die EU ihre digitale Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Durch den Weg in Richtung digitaler Souveränität signalisiert die Europäische Union ihr Engagement für ein sicheres, offenes und widerstandsfähiges Ökosystem für europäische Unternehmen und Verbraucher.
- Förderung von Open-Source-Hardware und -Software: Aufbau eines Open-Source-Ökosystems, das nicht auf die Lizenzierung geistigen Eigentums außerhalb der EU angewiesen ist. Beispielhaft steht hierfür die European Processor Initiative, die auf der offenen RISC-V-Hardwarearchitektur basiert und damit die Hürden für die Entwicklung innovativer Chips und Systeme senkt.
- Förderung von Innovation und Wettbewerb: Der Digital Markets Act (DMA) stärkt Innovationen und unterbindet unlauteres Verhalten digitaler Plattformen, die als Gatekeeper fungieren.
- Offener Zugang zu Supercomputern: Die Europäische Kommission hat den Zugang zu EU-Supercomputern für "europäische Start-ups im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), KMU und die breitere KI-Gemeinschaft" geöffnet, um die Entwicklung künstlicher Intelligenz in Europa zu beschleunigen.
Angesichts der Vorteile von Open Source für die digitale Souveränität sollte ein solches Ökosystem von Open-Source-Software angetrieben werden – mit weitreichenden Auswirkungen auf die Open-Source-Landschaft.
Open-Source-Software: Katalysator für Unabhängigkeit
Open-Source-Software hat sich als ein wesentliches Werkzeug für Organisationen – und sogar für ganze Länder – erwiesen, die digitale Autonomie anstreben. Durch die Nutzung von Open-Source-Software profitieren Organisationen von der Transparenz, Flexibilität und Anbieterneutralität, die in ihre Lizenzierung, Verteilung und kollektiven Entwicklungsmodelle eingebettet sind.
- Verringerung der Abhängigkeit von externen Technologieanbietern
- Möglichkeit zur eigenständigen Pflege und Weiterentwicklung der eingesetzten Software
- Größere Kontrolle über die digitale Infrastruktur und damit Sicherung der betrieblichen Autonomie
Wie Transparenz in Open Source Autonomie fördert
Im Gegensatz zu herkömmlicher (kommerzieller, proprietärer) Software ist Open-Source-Code öffentlich zugänglich und kann eingesehen, verändert und weiterverbreitet werden. Diese Transparenz bietet klare Vorteile:
- Perfekt zugeschnittene Softwarelösungen, die genau Ihren Anforderungen entsprechen und nicht an die Roadmap, Konventionen und Upgrade-Zyklen eines Anbieters gebunden sind.
- Aus dem offenen, kollaborativen FOSS-Entwicklungsmodell gehen in der Regel robustere und sicherere Lösungen hervor.
- Offene Standards verhindern Anbieterabhängigkeit und ermöglichen einen einfacheren Wechsel zwischen verschiedenen Anbietern.
- Eigene Technologie-Stacks besitzen, anstatt den Einfluss an dominante Marktakteure abzugeben.
- Investieren Sie in die lokale Wirtschaft, Unternehmen, Menschen und ihre Fähigkeiten.
- Schaffen Sie lokale Innovationsökosysteme und fördern Sie Gemeinschaft und Beteiligung.

TYPO3 und Open Source CMS tragen zur digitalen Souveränität bei
Offene Content-Management-Systeme (CMS) wie TYPO3 veranschaulichen, wie Software zur digitalen Autonomie beitragen kann. TYPO3 bietet Organisationen ein leistungsstarkes Werkzeug zur Erstellung und Verwaltung von Webinhalten, frei von kommerziellen Einschränkungen wie nutzungsbasierten Lizenzgebühren. Es bietet Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und ermöglicht es jedem, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, ohne durch proprietäre Softwarebegrenzungen eingeschränkt zu sein.
Als Open Source CMS profitiert TYPO3 auch von einer lebendigen professionellen Community, die kontinuierlich zur Weiterentwicklung beiträgt und sicherstellt, dass es stets auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklungen und Sicherheitsstandards bleibt. Gemeinsam mit anderen Open-Source-CMS wie Drupal, Joomla und WordPress befähigt TYPO3 Sie, Ihre digitale Präsenz effektiv und selbstbestimmt zu gestalten.
Digitale Souveränität vs. Datenhoheit: die Unterschiede verstehen
Im Diskurs um die technologische Selbstbestimmung tauchen häufig zwei Begriffe auf: digitale Souveränität und Datensouveränität. Diese Konzepte sind sehr eng miteinander verbunden.
- Digitale Souveränität ist die Fähigkeit einer Einrichtung, in allen digitalen Angelegenheiten unabhängig zu handeln, ohne ungebührlichen Einfluss von Dritten oder fremden Mächten. Ein Beispiel:
- Die Autorität einer Regierungsstelle über das digitale Ökosystem innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs: Infrastruktur, Netzwerke, Plattformen und andere technologische Fähigkeiten.
- Die Fähigkeit eines Unternehmens oder einer Organisation, die autonome Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte, Daten, Sicherheit und Betriebsabläufe zu bewahren.
- Digitale Governance ist die Regelungsbefugnis einer Organisation und ihre Maßnahmen zur Kontrolle ihres digitalen Betriebs, ihrer Richtlinien und ihrer Infrastruktur.
- Datensouveränität ist die Kontrolle einer Person oder eines Unternehmens über die von ihr/ihm erzeugten Daten, einschließlich des Ortes, an dem sie gespeichert werden können, wer auf sie zugreifen kann und wie sie verwendet werden können.
- Die Datensouveränität konzentriert sich insbesondere auf die Kontrolle der Datenerfassung, -speicherung, -weitergabe, des Datenschutzes und der Nutzungsrichtlinien gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
Datensouveränität und digitale Governance sind Teilbereiche der digitalen Souveränität
- Es gibt keine digitale Souveränität ohne Datensouveränität und digitale Governance. Wenn eine Einrichtung nicht die Kontrolle über ihre Systeme hat oder darüber, wer ihre Daten wie nutzt, ist sie nicht digital souverän.
Datensouveränität ist ohne vollständige digitale Souveränität möglich. Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) beispielsweise "schützt die Grundrechte und -freiheiten natürlicher Personen und insbesondere ihr Recht auf den Schutz personenbezogener Daten", ohne ihnen die Kontrolle über alle Systeme zu geben, die personenbezogene Daten speichern und verarbeiten können.
Praktische Auswirkungen der digitalen Souveränität
Die Erlangung digitaler Souveränität - mithilfe von Open-Source-Software - bietet nachweisbare und greifbare Vorteile.
Politische Entscheidungsträger und die Zivilgesellschaft profitieren davon:
- Unternehmen, die die Kontrolle über ihre Daten haben, können lokale Vorschriften besser einhalten.
- Die Einhaltung von Vorschriften erhöht die Glaubwürdigkeit und zieht mehr lokale Kunden an.
- Lokale Unternehmen wachsen und halten Talente und Einnahmen in der lokalen Wirtschaft.
Organisationen, die Open-Source-Technologien nutzen und dazu beitragen, profitieren:
- Gemeinsame Entwicklungskosten und -bemühungen
- Größere Kontrolle über Innovation und Funktionalität
Darüber hinaus hilft Open Source Ihnen, der digitalen Souveränität näherzukommen, indem:
- Sie sind weniger abhängig von ortsfremden Technologie- und Dienstleistungsanbietern
- Sie entscheiden können, wie und wo Ihre Daten verarbeitet und gespeichert werden
Der letzte Punkt, auch bekannt als Datenresidenz, ist besonders bedeutsam, da er die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen bestimmt, unter denen die Datenverarbeitung stattfindet.
Herausforderungen und Lösungen bei der Verwirklichung der digitalen Souveränität
Unternehmen und Regierungen stehen auf dem Weg zur digitalen Souveränität vor erheblichen Herausforderungen. Im Folgenden wird erläutert, warum Open-Source-Technologien unverzichtbar sind, um digitale Souveränität zu erreichen.
Häufige Herausforderungen in der digitalen Landschaft
Das vorherrschende Modell der Technologie-Beschaffung, das auf proprietärer Software oder proprietären Diensten basiert, stellt ein Hindernis für die digitale Souveränität dar. Um diese Hindernisse zu überwinden, sind in der Regel erhebliche Koordinierung, Ressourcen und technische Fähigkeiten erforderlich - mehr als die meisten Einzelpersonen oder Unternehmen im Alleingang aufbringen können.
- Datenschutzrisiken durch Drittanbieter
- Sicherheitsschwachstellen durch ungepatchten Closed-Source-Code
- Anbieterbindung, die die uneingeschränkte Nutzung eines Produkts verbietet
- Eingeschränkte Innovation durch restriktive Lizenzierung
Open-Source-Communitys wie TYPO3 stellen digitale Infrastruktur als gemeinschaftliches öffentliches Gut bereit und ermöglichen so die kollektive Selbstbestimmung, die die digitale Souveränität untermauert und vorantreibt.
- Transparenz: Analysieren und verstehen Sie den gesamten Open-Source-Code, den Sie verwenden.
- Mindert Risiken für die Privatsphäre
- Verringert Sicherheitsschwachstellen
- Multi-Vendor-Service-Landschaft: Arbeiten Sie mit lokalen Open-Source-Experten zusammen.
- Eliminiert die Anbieterabhängigkeit
- Fördert die Lokalisierung und Anpassung
- Investiert Projektbudgets in Ihre lokale Wirtschaft
- Freie Lizenzierung schützt und unterstützt Mitwirkende und Nutzer.
- Belohnt Beiträge und stärkt dadurch die Gemeinschaft
- Ermöglicht kollektive Entwicklung
- Verteilt die Kosten und den Nutzen der Innovation
TYPO3s Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen digitaler Souveränität
Die lebendige professionelle Community in und um TYPO3 investiert aktiv in die digitale Souveränität aller, die das System nutzen.
Mit dem TYPO3 CMS:
- Behalten Sie die Kontrolle über Ihre geschäftskritische Infrastruktur
- Profitieren Sie von dezentraler, gemeinschaftsgetriebener Innovation
- Begegnen Sie weniger Sicherheitsrisiken dank transparentem, überprüfbarem Code
- Vermeiden Sie Anbieterabhängigkeit und fördern Sie lokale sowie regionale Beiträge durch offene Standards
Die TYPO3-Community unternimmt auch aktiv Schritte, um den Weg für digitale Souveränität zu ebnen.
- Um den Grad der Unterstützung für digitale Souveränität zu evaluieren, schlägt Anastasia Schmidt von CPS Berlin vor, einen Index für digitale Souveränität am Beispiel von TYPO3 zu konzipieren, um Organisationen bei der Auswahl eines geeigneten CMS zu helfen.
- Die T3CON23 veranstaltete eine Podiumsdiskussion zum Thema Regierung und digitale Souveränität, die den aktuellen Stand und die zukünftigen Möglichkeiten der digitalen Souveränität im öffentlichen Sektor bis Ende 2023 untersuchte.
Praxisbeispiele und Fallstudien zur digitalen Souveränität
Um den Übergang von der Theorie in die Praxis zu erleichtern, finden Sie hier einige Fallstudien aus unterschiedlichen Kontexten. Jede Maßnahme, die Sie zur Förderung digitaler Autonomie umsetzen können, ist ein Fortschritt.
Digitale Souveränität in der Praxis
Die staatliche Macht und Kontrolle über Technologie kann sich auf unterschiedliche Weise manifestieren – etwa durch die Regulierung von Online-Aktivitäten und Akteuren, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Technologiekonzernen oder den Schutz von Daten. Die folgenden Fallstudien verdeutlichen einige der Herausforderungen und Chancen, mit denen nationale Regierungen konfrontiert sind, wenn sie digitale Souveränität mit dem Bedarf an Regulierung, technologischer Innovation und Datenschutz in Einklang bringen müssen.
- GAIA-X ist ein deutsch-französisch initiiertes europäisches Cloud-Computing-Projekt, das die Abhängigkeit von großen außereuropäischen Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure oder Alibaba Cloud verringern soll. Es ist als dezentrales, föderiertes System konzipiert, das bestehende Cloud-Dienste in Europa miteinander verbindet. Das Projekt basiert auf gemeinsamen Standards und entspricht europäischen Vorschriften wie der DSGVO. GAIA-X zielt darauf ab, die europäische digitale Souveränität zu stärken, indem es eine sichere und transparente Cloud-Infrastruktur schafft, die auf europäischen Werten beruht.
- Der US CLOUD Act: Der US CLOUD Act zeigt die Komplexität auf, die entsteht, wenn nationale Gesetze extraterritoriale Auswirkungen haben. Er erlaubt US-Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf Daten, die außerhalb der USA gespeichert sind. Dies hat zu Konflikten mit anderen Ländern, insbesondere mit der EU, geführt – vor allem im Hinblick auf Datenschutz, Bürgerrechte und digitale Souveränität.
- Blockchain und GDPR in Frankreich: Die französische Datenschutzbehörde (CNIL) veröffentlichte 2018 Richtlinien zur Vereinbarkeit der DSGVO mit Distributed-Ledger-Technologien (DLT) bzw. Blockchain. Damit wird versucht, nationale Regulierungsanforderungen und technologische Unabhängigkeit miteinander in Einklang zu bringen.
- Estlands digitale Plattform: Estlands Einsatz einer blockchainbasierten digitalen Plattform für öffentliche Dienstleistungen verdeutlicht das Engagement des Landes für digitale Souveränität. Der innovative Ansatz umfasst unter anderem eine „Datenbotschaft“ in Luxemburg, die zusätzlichen Schutz vor potenziellen Cyberangriffen oder einer Invasion bietet. Dieses Beispiel zeigt, wie Staaten Technologie nutzen können, um eine effiziente und sichere Verwaltung zu gewährleisten.
TYPO3 an der Spitze: Praxisbeispiele aus dem Einsatz
TYPO3 CMS ist eine bewährte, robuste Plattform für Behörden und Organisationen, die Autonomie und Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur, Daten und Dienste anstreben. Hier sind einige Beispiele aus der Praxis:
- Regierung Deutschlands: Die deutsche Bundesregierung hat TYPO3 als CMS für den Government Site Builder (GSB) ausgewählt, der in allen Ministerien eingesetzt wird. Diese Entscheidung ist ein klares Bekenntnis zu Open-Source-Technologie und zeigt das Vertrauen der Regierung in die Leistungsfähigkeit von TYPO3.
- Regierung von Ruanda: Ruanda hat TYPO3 als nationalen Webseitenstandard für seine öffentlichen Institutionen eingeführt. Diese Entscheidung wurde durch das TYPO3 Community Expansion Committee unterstützt und verdeutlicht die Anpassungsfähigkeit und Eignung des Systems für den großflächigen Einsatz im öffentlichen Sektor.
- Websites der britischen Liberaldemokratischen Partei: Der Entwickler Matt Raines von Prater Raines nutzte TYPO3 CMS, um über 300 Webseiten für die Liberal Democrats im Vereinigten Königreich zu erstellen. Dieses Projekt veranschaulicht den Einsatz von TYPO3 im politischen Kontext und zeigt, wie das System digitale Souveränität in unterschiedlichen Bereichen unterstützen kann.

Highlight der T3CON23: Podiumsdiskussion zum Thema Regierung und digitale Souveränität
Eine viel beachtete Podiumsdiskussion auf der T3CON23 befasste sich mit den Anwendungen der digitalen Souveränität im öffentlichen Sektor und den damit verbundenen Herausforderungen. Die Podiumsteilnehmer, die über umfangreiche Erfahrungen mit digitalen Projekten der öffentlichen Hand verfügen, waren sich einig, dass Open-Source-Software wie TYPO3 für Regierungen unerlässlich ist, um digitale Souveränität zu gewährleisten und den größten Nutzen aus öffentlichen Mitteln zu ziehen.
Matt Raines, Entwickler bei Prater Raines, erläuterte, wie sein Unternehmen mithilfe von TYPO3 das Web-Portfolio der britischen Liberaldemokraten umgestalten konnte. Er argumentierte, dass Open Source es ermöglicht, dass öffentliche Ressourcen der Öffentlichkeit zugutekommen, lokales Know-how gefördert wird und eine digitale Wirtschaft entsteht.
Jana Höffner von der Agentur Ressourcenmangel beschrieb die Herausforderungen bei der Ausrichtung der komplexen deutschen Behördenlandschaft auf digitale Strategien. Sie leitete erfolgreich die Überarbeitung der Webseiten des Landes Baden-Württemberg mithilfe von TYPO3 und ersetzte damit proprietäre Software. Dadurch wurde die Bindung an einen bestimmten Anbieter aufgehoben, die Tür für lokale Dienstleister geöffnet und die Landesregierung in die Lage versetzt, einen Beitrag zur Open-Source-Community zu leisten. Höffner schlug vor, Open Source in Beschaffungsverträgen zu verankern, da es ihrem Bundesland Vorteile gebracht habe.
Nikolai Jaklitsch vom ITZBund erläuterte, wie der Einsatz von TYPO3 dabei hilft, Lizenzkosten einzusparen, sodass Steuergelder stattdessen in öffentliche Dienstleistungen fließen können. Er hob hervor, dass der Auftrag staatlicher Webseiten darin bestehen sollte, Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern aufzubauen – und nicht in Eigenwerbung. Dies sei besonders in Krisenzeiten entscheidend, etwa während der Corona-Pandemie, als klare und verlässliche Kommunikation auf den Bundeswebseiten von größter Bedeutung war. TYPO3, so Jaklitsch, biete mit seinem Core und den Erweiterungen ideale, zweckorientierte Werkzeuge für vertrauensbildende Online-Kommunikation.
Alle Podiumsteilnehmer betonten, dass TYPO3 dank seiner Enterprise-Tauglichkeit für komplexe Regierungswebseiten, seiner Erweiterbarkeit zur Verbesserung öffentlicher Dienste und seiner langjährigen Community-Wissenskultur dazu beiträgt, Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die digitale Souveränität zu stärken.
Zukünftige Trends und Prognosen
Die Erreichung digitaler Souveränität ist eine Reise, kein Ziel. Sobald Sie Ihre Autonomie erlangt haben, sollten Sie sie nicht als selbstverständlich ansehen. Veränderungen in der digitalen Landschaft können Ihre Kontrolle über Daten oder Systeme gefährden. Weit verbreitete Open-Source-Software wie TYPO3 und die hier erwähnten anderen CMS sind dabei starke Verbündete.
Die Beitragenden und Dienstleister im TYPO3-Ökosystem entwickeln kontinuierlich neue Lösungen für ihre Kunden ebenso wie für sich selbst. Sie stehen an der Spitze der technischen Innovation. Sie profitieren von neuen Chancen, sobald sie entstehen, und sind gleichzeitig geschützt, da Risiken frühzeitig erkannt und in der Software behoben werden.
Ihre Open-Source-Software passt sich an und entwickelt sich mit Ihren Anforderungen und technologischen Paradigmen weiter. Sie bildet die Grundlage für eine nachhaltige digitale Autonomie.
Neue Technologien und digitale Souveränität
Das Wesen der digitalen Souveränität dreht sich um die zentralen Fragen: Was gehört mir? Und was kontrolliere ich? Neue Technologien, Bedrohungen und Chancen treiben uns unaufhaltsam in eine Zukunft, in der digitale Souveränität kein Nice-to-have, sondern ein strategischer Imperativ ist.
Für Einzelpersonen wie auch Organisationen wurde das Dilemma oft als Entweder-oder-Entscheidung dargestellt: die Wahl zwischen einer proprietären Lösung oder einer vollständig eigenen Entwicklung. Doch diese Sichtweise übersieht eine entscheidende dritte Option: den Einsatz von Open-Source-Technologien, die einen einzigartigen Mittelweg bieten. Anstatt nur passive Konsumenten zu sein, ermutigt Open Source die Nutzerinnen und Nutzer, sich aktiv an der Weiterentwicklung der Produkte zu beteiligen, die sie selbst verwenden.
TYPO3 steht im Zentrum dieser Diskussion im CMS-Bereich. Sein flexibler, skalierbarer und gemeinschaftsorientierter Ansatz zeigt beispielhaft, wie Open-Source-Plattformen dazu befähigen, die eigenen technologischen Werkzeuge zu besitzen und zu kontrollieren. Über den reinen Code hinaus prägen Open-Source-Gemeinschaften zunehmend Politik, Governance und den ethischen Einsatz von Technologie.
Die sich wandelnde Rolle von Open-Source-CMS im Kontext digitaler Souveränität
Die digitale Welt ist inhaltsgetrieben. Content-Management-Systeme ermöglichen es uns allen, digitale Inhalte zu erstellen und zu verwalten. Open-Source-CMS geben uns die Autonomie und Flexibilität, dies nach unseren eigenen Vorstellungen zu tun, und bringen digitale Souveränität für viele in greifbare Nähe.
Mit Open-Source-Werkzeugen können Sie Ihre digitale Präsenz selbst gestalten, betreiben und steuern, ohne von proprietären Anbietern abhängig zu sein. So behalten Sie die Kontrolle über die Verbreitung von Informationen und Ihre Interaktion mit anderen Akteuren im digitalen Ökosystem.
Der Weg in die Zukunft für digitale Souveränität und Open Source
Digitale Souveränität ist im digitalen Zeitalter ein entscheidendes und vielschichtiges Thema. Open-Source-Projekte sind dabei ein zentraler Verbündeter, um technologische Autonomie zu erreichen.
- Digitale Souveränität bedeutet Unabhängigkeit: Wer seine IT-Infrastruktur auslagert, riskiert den Verlust der Kontrolle über digitale Vermögenswerte – insbesondere bei der Abhängigkeit von internationalen Dienstleistern. Digitale Souveränität bedeutet, dass Unternehmen und Regierungen ihre digitale Präsenz und ihre Daten eigenständig und frei von externer Kontrolle verwalten können. Dies ist entscheidend, um die betriebliche Autonomie zu sichern.
- Open Source als Katalysator: Open-Source-Software ist ein Schlüsselelement digitaler Souveränität, da sie Freiheit von proprietären Beschränkungen bietet und eine transparente Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung ermöglicht. Historische Meilensteine wie das GNU-Projekt und der Linux-Kernel verdeutlichen die zentrale Rolle freier und offener Software, die Nutzerinnen und Nutzern Kontrolle und Verantwortung über ihre technologischen Werkzeuge verleiht.
- Herausforderungen für die digitale Souveränität und die europäische Antwort: Der Weg zur digitalen Souveränität ist mit Herausforderungen verbunden – etwa mit Risiken für den Datenschutz und der Gefahr von Anbieterabhängigkeit. Trotz dieser Hürden ist die Europäische Union ein herausragendes Beispiel für entschlossenes Handeln: Mit Initiativen wie der DSGVO und der strategischen Einführung von Open-Source-Lösungen wie TYPO3 stärkt sie lokale Innovation und Autonomie und setzt ein klares Zeichen für ein souveränes digitales Europa.
TYPO3 – Ihr Partner auf dem Weg zur digitalen Souveränität
Seit seinen Anfängen lebt das TYPO3 Projekt den Geist von Open Source - und setzt ihn in konkrete digitale Infrastruktur um. nd das tun wir bis heute. Die Entwicklung von TYPO3 unterstützt Sie auf Ihrem eigenen Weg zur digitalen Souveränität. Wir bekennen uns kompromisslos zu den Werten von Open Source, die wiederum entscheidend dafür sind, dass Sie technologische Autonomie und Kontrolle erreichen können.
Das TYPO3 CMS ist mehr als nur ein Werkzeug – unsere Community und Technologie sind Ihre Verbündeten im Streben nach digitaler Unabhängigkeit. TYPO3 baut Barrieren ab und fördert Innovation, Fachwissen und Eigenständigkeit, indem es Gemeinschaften und Regierungen weltweit eine leistungsfähige und anpassungsfähige Plattform zur Verfügung stellt.
Unser Projekt unterstreicht die Bedeutung Ihrer Freiheit, unsere Software frei von proprietären Lizenzbeschränkungen zu entwickeln, zu verändern und zu nutzen. Die Erfolgsgeschichten, wie die aus der Zusammenarbeit mit Ruanda, unterstreichen die zentrale Rolle von TYPO3 bei der Gestaltung einer Zukunft, in der digitale Souveränität nicht nur ein Ideal, sondern eine konkrete Realität für alle ist.


